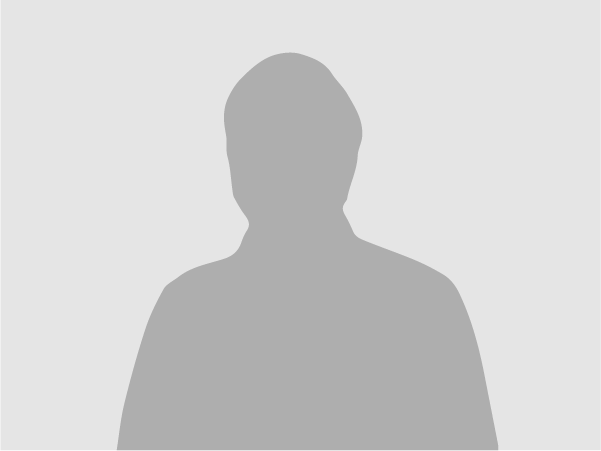Arzt und Patient: Beziehung verbessern – Schmerzen lindern

Heidelberg – Eine gute Beziehung zwischen Arzt und Patient ist nicht nur wichtig, um gemeinsam die bestmögliche Behandlungsstrategie zu finden. Sie kann sich auch auf die Therapietreue und den dauerhaften Behandlungserfolg auswirken. Fällt es einem Patienten eher schwer, Bindungen aufzubauen, und weiß der Arzt mit den speziellen Bedürfnissen eines solchen Patienten nicht entsprechend umzugehen, haben gängige Therapiekonzepte häufig weniger Erfolg – gerade bei der Therapie chronischer Schmerzen. Wie Patienten in solchen Fällen besser geholfen werden kann, untersuchen Heidelberger Wissenschaftler derzeit in einer Studie zu chronischen Rücken- und Nackenschmerzen.
Ihr Ansatz: Mit einer sogenannten bindungsorientierten Schmerztherapie, die den Aufbau einer vertrauensvollen Arzt-Patient-Beziehung und das Bindungsverhalten des Patienten bewusst in den Mittelpunkt stellt, wollen sie die Therapieergebnisse verbessern und Patienten dabei unterstützen, deren chronische Schmerzen langfristig zu lindern. Im Rahmen der Studie untersucht die Psychologin Ann-Christin Pfeifer, Nachwuchswissenschaftlerin an der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Heidelberg, deshalb die Behandlungsergebnisse und die subjektive Arzt-Patient-Beziehung von 150 Patienten mit lange bestehenden Rücken- und Nackenschmerzen nach einer vierwöchigen bindungsorientierten Schmerztherapie.
Bindungshormon Oxytocin beeinflusst Schmerzwahrnehmung
Ein weiterer untersuchter Faktor ist dabei außerdem der Anteil des „Bindungshormons“ Oxytocin im Blut der Patienten und wie sich dieser im Verlauf der Therapie verändert. Bereits in anderen Studien konnte festgestellt werden, dass Oxytocin sich nicht nur positiv auf die Bindungsfähigkeit und die Vertrauensbildung in Beziehungen auswirkt, sondern auch die Schmerzempfindlichkeit reduzieren kann. „Oxytocin beeinflusst verschiedene Hirnareale, die für die Kontrolle von Angst und sozialem Verhalten, für das Wohlbefinden und die persönliche Schmerzschwelle verantwortlich sind,“ erklärt Pfeifer. So konnte etwa gezeigt werden, dass der Oxytocin-Spiegel bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen niedriger ist als bei gesunden Personen.
Zusammenhang von körperlichen und psychischen Faktoren
Deshalb vermuten die Forscher einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Hormon Oxytocin, dem Bindungsverhalten eines Patienten und der persönlichen Schmerzwahrnehmung, den sie in ihrer Studie nun genauer untersuchen wollen. „Das Ziel unserer Studie ist es festzustellen, wie körperliche Symptome und psychische Faktoren zusammenhängen. Mit dem, was wir daraus lernen, wollen wir die Wirkung einer bindungsorientierten Schmerztherapie besser beurteilen können und unsere Therapiekonzepte weiter verbessern“, sagt Pfeifer.
Mit ihrem bindungsorientierten Therapieansatz, der das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient stärken und so dann indirekt auch Schmerzen lindern soll, wollen die Mediziner insbesondere den Patienten besser helfen, denen es schwerer fällt als anderen, neue Bindungen aufzubauen. Rund zwei Drittel der chronischen Schmerzpatienten gelten als „unsicher gebunden“, wie Psychologen es nennen. Häufig geht dies auf Erlebnisse aus der Kindheit zurück, die zu Bindungsangst oder Bindungsvermeidung führen können. Doch auch in der Gesamtbevölkerung ist diese Zuschreibung nicht selten: Bis zu ein Drittel der Bevölkerung gilt als davon betroffen. Umso wichtiger sei es, diese Erkenntnisse in die moderne Schmerztherapie einfließen zu lassen, so Pfeifer.
Ein Gespür für die Bedürfnisse des Patienten entwickeln
Bereits heute kommt bei chronischen Schmerzpatienten häufig eine sogenannte multimodale Schmerztherapie zum Einsatz. Diese umfasst körperliche und psychosoziale Aspekte und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Ärzte, Physiotherapeuten und Psychologen den Patienten gemeinsam behandeln und aktiv in den Behandlungsprozess einbeziehen. „Der bindungsorientierte Aspekt ist eine Art Zusatz zur multimodalen Schmerztherapie. Ärzte und Therapeuten versuchen dabei, offen zu sein für die speziellen und oft unterschiedlichen Bedürfnisse von Patienten mit einem unsicheren Bindungsverhalten“, so Pfeifer.
Das sei nicht selbstverständlich, meint Prof. Dr. Marcus Schiltenwolf, Leiter der konservativen Orthopädie und Schmerztherapie an der Orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg und einer der Leiter der Studie. Denn oft falle es Ärzten schwer, die individuellen Beziehungsbedürfnisse ihrer Patienten zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. „Wir hoffen insbesondere, dass wir Ärzten anhand unserer Studienergebnisse einen praktischen Leitfaden an die Hand geben können, wie sie Patienten mit unsicherem Bindungsverhalten besser erkennen und entsprechend auf sie eingehen können, um eine gute und vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung aufzubauen“, erklärt Schiltenwolf.

So können Patienten mit einem unsicherem Bindungsverhalten zu Angst oder abwehrendem Verhalten neigen: „Ängstlichen Patienten, denen es schwerfällt herauszufinden, was ihre Schmerzen lindert oder vermeiden hilft, tut mehr Beruhigung und Unterstützung von ihrem Arzt gut“, so Schiltenwolf. Patienten, die beim Arzt viel schweigen und denen es schwerfällt, um Hilfe zu bitten, sollte man als Arzt mit Geduld und Verständnis begegnen, sich quasi vorsichtig herantasten. „Solche Patienten schätzen vor allem eine gute Rückversicherung zum Befund und den Therapiemaßnahmen. Es fällt ihnen dann leichter, sich auf den Arzt und seine Empfehlungen einzulassen“, erklärt der Studienleiter. „Letztendlich geht es darum, dass der Patient sich verstanden fühlt und mit dem, was der Arzt ihm sagt, etwas anfangen kann, sodass er danach mit möglichst wenig Angst mit seinem Befund auch gut zu leben weiß“, so Schiltenwolf.
So wie Ärzte und Therapeuten versuchen sollten, ein noch besseres Gespür für ihre Patienten zu entwickeln, könne auch der Patient zu einem besseren Therapieerfolg beitragen, meint Schiltenwolf: „Wenn auch der Patient ein besseres Gespür für sich selbst entwickelt und seine Tendenzen zu starker Sorge oder Abwehr erkennt, ist das vielleicht ein Anfang. Er kann dann nach und nach mehr Vertrauen in sich selbst, aber auch in andere gewinnen. So ist es ihm auch möglich, ärztliche Hilfe besser anzunehmen.“