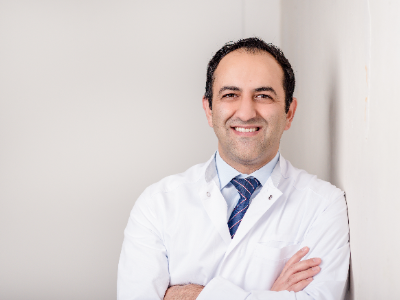Morbus Ahlbaeck
Der Morbus Ahlbaeck ist eine seltene Erkrankung, die sich durch ein spontan auftretendes Absterben von Knochengewebe (Osteonekrose) am Kniegelenk auszeichnet. Dabei ist meist die innere Oberschenkelrolle an der Innenseite des Gelenks betroffen.

Die oft weiblichen Patienten höheren Alters leiden anfangs unter plötzlich auftretenden Schmerzen, einer Gelenkschwellung und Flüssigkeitsansammlungen im Gelenk (Ergüsse), ohne dass zuvor eine entsprechende Verletzung aufgetreten ist. Die Erkrankung wurde nach dem Stockholmer Radiologen Ahlbaeck benannt, der das Krankheitsbild als einer der ersten 1968 beschrieb.

Auftreten und Häufigkeit
Die Erkrankung kann sowohl an der Innenseite als auch seltener an der Außenseite des Kniegelenks auftreten, in etwa sieben Prozent der Fälle sind beide Kniegelenke betroffen.
Die Erkrankung tritt vorwiegend im höheren Lebensalter auf, vereinzelt können Patienten aber auch bereits im mittleren Lebensalter davon betroffen sein. Der Morbus Ahlbaeck tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern.
Ursachen und Risikofaktoren
Die genauen Ursachen der Erkrankung sind noch nicht abschließend geklärt. Bereits bekannte Einflussfaktoren sind Durchblutungsstörungen, Fettstoffwechselstörungen, Gicht, Alkoholismus und Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). Weitere Risikofaktoren können auch vorangegangene Meniskusverletzungen und Achsfehlstellungen (meist O-Bein) sein.
Symptome und Verlauf
Bei erkrankten Patienten zeigt sich ein akut einsetzender Belastungs- und Ruheschmerz an den betroffenen Gelenkbereichen, der den Schmerzen bei einem eingeklemmten Meniskus ähnelt. Weitere Symptome sind Kapselschwellungen, unspezifische Flüssigkeitsansammlungen im Gelenk (Ergüsse), Schonhinken, Bewegungseinschränkungen und eine zunehmende Verschiebung der Beinachse hin zu einem O-Bein. Unbehandelt führt die Erkrankung schließlich zu einem Verschleiß des Kniegelenks (Kniearthrose). Im Anfangsstadium sind allerdings auch Spontanheilungen möglich.
Diagnose
Die wichtigsten Differentialdiagnosen, die vom Arzt zunächst ausgeschlossen werden müssen, sind Osteochondrosis dissecans OCD (hier ist primär der Knorpel betroffen, beim Morbus Ahlbaeck kommt es erst sekundär zum Knorpelschaden), verschleißbedingte Meniskusverletzungen und eine Kniearthrose durch Fehlbelastung bei Achsfehlstellungen. Daneben sind unter anderem bakterielle (auch tuberkulöse) Entzündungsherde oder weitere Knochennekrosen, verursacht zum Beispiel durch die Bluterkrankheit oder die lange Einnahme von Kortikosteroiden, mögliche Differentialdiagnosen.
Bei der Diagnostik ähneln die Befunde von Patienten mit Morbus Ahlbaeck oft sogenannten „Flake fractures“, kleinen Abriebstellen des Knorpels und gegebenenfalls auch angrenzender Knochenstücke, diese entstehen jedoch unfallbedingt. Eine sorgsame Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) und körperliche Untersuchung des Patienten ist daher notwendig.
In den Anfangsstadien war der Morbus Ahlbaeck nur mit Hilfe einer Szintigraphie (bildgebendes Verfahren) erkennbar, das Röntgenbild ist unauffällig, später ist das absterbende Knochengewebe dann auch bei einer Röntgenuntersuchung erkennbar. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Möglichkeiten einer frühen Diagnose durch die Kernspintomographie (MRT) und die Arthroskopie verbessert.
Da der Morbus Ahlbaeck jedoch eine eher seltene Erkrankung ist, sollte die Durchführung eines MRT erst dann erfolgen, wenn die Basisdiagnostik mit Anamneseerhebung, klinischer Untersuchung, konventionellem Röntgen und gegebenenfalls Ultraschalluntersuchungen durchgeführt wurde und der gesamte Verlauf auf eine solche Erkrankung hindeutet.
Therapie
Die Therapieformen reichen je nach Stadium von konservativen Maßnahmen über operative Eingriffe bis hin zur Endoprothetik. In den Anfangsstadien steht zunächst die konservative Therapie mit entlastenden und schmerzlindernden Maßnahmen im Mittelpunkt. Dazu gehören zum Beispiel Gehstützen und eine Schuhaußenranderhöhung, die Gabe von schmerzstillenden und entzündungshemmenden Medikamenten (Analgetika und Antiphlogistika) sowie die Punktion von Flüssigkeitsansammlungen, von intraartikulären Injektionen mit Kortikosteroiden wird abgeraten.
In einigen Fällen kann auch der Einsatz der pulsierenden Magnetfeldtherapie sinnvoll sein, da diese gerade in früheren Stadien in manchen Fällen die Ausheilung befördert oder das Fortschreiten aufhalten oder zumindest verlangsamen kann. Hier liegen zwar eine Reihe wissenschaftlicher Studien vor, die Wirksamkeit ist allerdings noch nicht endgültig wissenschaftlich nachgewiesen.
Je nach Ausmaß der Erkrankung können auch gelenkerhaltende Operationen notwendig sein, die in der Regel arthroskopisch (minimalinvasiv) und nur selten offen durchgeführt werden. So kann zum Beispiel durch Anbohrungen die Durchblutung im Gelenk verbessert werden. Mithilfe einer sogenannten Spongiosaplastik kann das Gelenk mit neuem Knochengewebe aufgefüllt und so wiederaufgebaut werden. Eine weitere operative Möglichkeit ist eine Umstellung des Schienbeinkopfes zur Entlastung des Kniegelenks.
Reichen diese Maßnahmen nicht mehr aus, weil die Knochennekrose zu weit fortgeschritten ist, oder zeigen sie nach der Durchführung keinen ausreichenden Erfolg, so ist schließlich häufig eine endoprothetische Versorgung mit einer Knieteilprothese (Schlitten) oder einem kompletten Kunstgelenk (Knieprothese) notwendig.
Literatur und weiterführende Links
Ahlbaeck, S.: Osteonecrosis of the knee – radiographic observations. Calcif Tissue Res.,1968, Suppl. 36-36b
Ahlbaeck, S:, Bauer, G.C., Bohne, W.H.: Spontaneus osteonecrosis of the knee. Arthritis Rheum., 1968,11(6), 705-733.
Albers, E., Blumlein, H., Suhler, H.: Spontane Femurkondylennekrose des Knies (Ahlbaeck). Zentralbl. Chir., 1985,110(10),607-12.
Bohne, W., Muheim, G.: Spontane Osteonekrose des Kniegelenks. Z Orthop.,1970,107(3),384-402.
Forst, J., Forst, R., Heller, K.D., Adam, G.: Spontaneous osteonecrosis of the femoral condyle: causal treatment by early core decompression. Arch Orthop Trauma Surg., 1998,117(1-2),18-22.
Grüner, S.: Vier Jahrzehnte mediale Femurkondylusosteonekrose Morbus Ahlbaeck. Orthopädische Praxis, 2003, 39(11),672-674
Hassenpflug, J., Blauth, W.: Die spontane Osteonekrose des Kniegelenkes. In: Hohmann, D.: Das Knie. Reihe Praktische Orthopädie, Bd.11, Storck, Bruchsal,1981,145-158.
Hipp, E., Aigner, R.: Osteochondrorse des älteren Menschen (Morbus Ahlbäck). In: Witt, A.N., Rettig, H., Schlegel, K.F.: Orthopädie in Praxis und Klinik, Band VII, Teil I. Thieme, Stuttgart,1987,2.59.
Jerosch, J.: Morbus Ahlbäck – Möglichkeiten der Therapie. Chir. Praxis,2001,59(2),217.
Ninol, G.: Spontane Osteonekrose am Kniegelenk (Ahlbaeck). Röentgen-Blätter,1979,32(8),442-6
Schönbauer, H.R., Polt, E., Grill, F.: Orthopädie – Methodische Diagnostik und Therapie. Springer, Wien, 1979,469.
Wirth, C.: Degenerative Erkrankungen des Kniegelenks – Spontane Osteonekrose Ahlbäck.
In: Jäger, M., Wirth, C.J. (Hrsg.): Praxis der Orthopädie. Thieme, Stuttgart, 2. Auflage, 1992, 961-2.
Wirth, C. (Hrsg.): Kniegelenk – Spontane Osteonekrose Ahlbäck. In: Wirth, C.J.: Praxis der Orthopädie, Band II. Thieme, Stuttgart, 3. Auflage, 2001, 522.