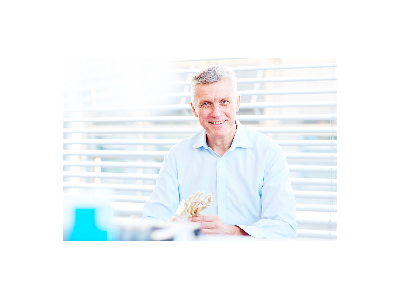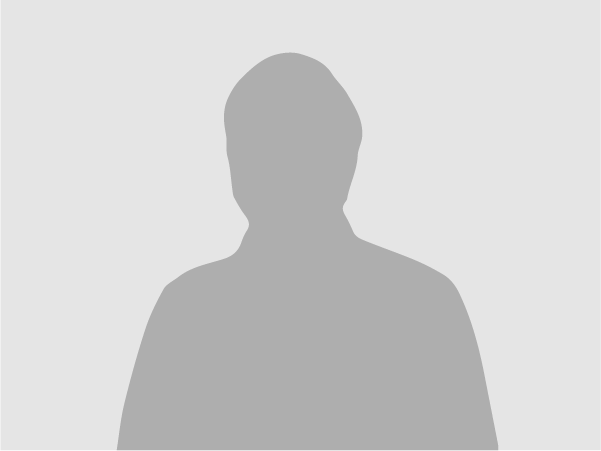Riss der Rotatorenmanschette
Die Rotatorenmanschette ist eine Muskel-Sehnen-Platte, die den Oberarmkopf umgibt und als wichtiger Bestandteil des Bewegungsapparates der Schulter fungiert. Zu Rissen der Rotatorenmanschette kommt es hauptsächlich aufgrund von Abnutzung (sogenannte degenerative Rupturen). Seltener treten unfallbedingte Risse auf (sogenannte traumatische Rupturen).

Die Rotatorenmanschette besteht aus insgesamt vier Muskeln und ihren Sehnenansätzen am Oberarmkopf. Die Muskeln entspringen allesamt dem Schulterblatt und ziehen wie eine Haube mit ihren Sehnen um das Schultergelenk beziehungsweise den Oberarmkopf und sorgen mit dafür, dass der Arm abgespreizt, nach innen und außen gedreht werden kann. Außerdem hält die Rotatorenmanschette den Oberarmkopf mittig im Gelenk und ermöglicht ein harmonisches Gleiten in alle Bewegungsrichtungen. Man unterscheidet den Musculus subscapularis (Innendreher, vorderer Muskel der Rotatorenmanschette), den Musculus supraspinatus (Abspreizer, oberer Muskel der Rotatorenmanschette) und die beiden hinteren Muskeln, die unter anderem für die Außendrehung zuständig sind (Musculus infraspinatus und teres minor).
Häufigkeit
Die Rotatorenmanschettenruptur ist die mit Abstand häufigste Erkrankung der Schulter. Das Risiko für diese Verletzung steigt mit zunehmenden Alter und Funktionsanspruch an die Schulter. Am häufigsten ist die Sehne des Musculus supraspinatus betroffen. Eine Rotatorenmanschettenruptur kann lange Zeit ohne Symptome, also asymptomatisch verlaufen und unter Umständen viele Jahre unentdeckt bleiben. Daher ist auch von einer hohen Dunkelziffer der Betroffenen auszugehen.
Ursachen und Risikofaktoren
Man unterscheidet abnutzungsbedingte (degenerative) von unfallbedingten (traumatischen) Rotatorenmanschettenrupturen. Rein traumatische Risse sind deutlich seltener und treten vor allem bei Stürzen auf den angelegten oder abgespreizten Arm auf.
Häufiger sind sogenannte akut-auf-chronische Schäden der Rotatorenmanschette. Hierbei führt eine Verletzung ohne große Krafteinwirkung oder lediglich eine ruckartige Bewegung der Schulter beziehungsweise des Armes, zu einem Abriss der bereits vorgeschädigten (degenerierten) Sehne(n). Wie alle Strukturen im Körper unterliegt auch die Rotatorenmanschette einem gewissen Alterungsprozess und die Sehnenplatte nimmt über die Jahre an Dicke ab, sodass es schlussendlich zu einer Ruptur kommen kann. Dieser Prozess kann durch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel vermehrte Belastung, wiederholte Verletzungen oder Rauchen, beschleunigt werden. Als Risikofaktoren sind außerdem die sogenannte Kalkschulter und das subacromiale Impingement (Einklemmungsphänomen unter dem Schulterdach) beschrieben.
Symptome und Verlauf
Die Symptome der Rotatorenmanschettenruptur reichen von kompletter Beschwerdefreiheit bis hin zu massiven Schulterschmerzen mit stark eingeschränkter Beweglichkeit und Kraftverlust. Welche Patienten asymptomatisch bleiben und welche symptomatisch werden ist letztlich nicht endgültig geklärt. Patienten berichten häufig über Schulterschmerzen, die anfangs gering ausgeprägt sind und nur unter Belastung auftreten und im Verlauf an Intensität zunehmen und auch in Ruhe bestehen. Teilweise kann ein auslösendes Ereignis beschrieben werden. Durch den Abriss einer oder mehrerer Muskel-Sehnen-Ansätze kann es zu Bewegungseinschränkungen der Schulter kommen und außerdem zu einem Kraftverlust.
Man unterscheidet Teileinrisse (sogenannte Partialrupturen) von den Komplettrupturen. Häufig gehen diese auch ineinander über, sodass ein Riss im Verlauf an Größe zunehmen kann. Bei dem kompletten Abriss eines Muskels kann sich die Sehne relativ schnell (binnen weniger Wochen) zurückziehen und der Muskel verfetten. Dieses Phänomen ist an der Schulter relativ einzigartig und stellt ein großes Problem dar, vor allem für die Möglichkeiten der operativen Rekonstruktion. Bleibt eine Rotatorenmanschettenruptur unentdeckt beziehungsweise unbehandelt, kann es im Verlauf zur Entwicklung einer sogenannten Defektarthropathie kommen. Hierbei verschiebt sich der Oberarmkopf in der Gelenkpfanne (Dezentrierung), was durch die fehlende oder gerissene Rotatorenmanschette bedingt wird. Die Folge ist ein starker Verschleiß der Gelenkpartner (Oberarmkopf und Gelenkpfanne) sowie des Knorpels (Arthrose). Ob und wie schnell es zu einer Defektarthropathie kommt, hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab und ist sehr individuell.
Diagnose
Mithilfe der Erfassung der Krankengeschichte (Anamnese) und einer gezielten körperlichen Untersuchung lassen sich Rückschlüsse auf die Unversehrtheit oder Schädigung der Rotatorenmanschette ziehen. Besteht der Verdacht auf eine Ruptur der Rotatorenmanschette, sollte sich eine radiologische Bildgebung anschließen. Der Ultraschall (Sonographie) ist ein dynamisches Untersuchungsverfahren und erlaubt eine Einschätzung zur Unversehrtheit der Rotatorenmanschette. Um tieferliegende Strukturen oder ein eventuelles Zurückziehen der Sehnen oder eine Verfettung der Muskeln beurteilen zu können, ist eine Magnetresonanztomographie (MRT) notwendig. Welche Verfahren zum Einsatz kommen, wird individuell, anhand der vorliegenden Befunde entschieden.
Therapie und Nachsorge
Die Therapie richtet sich vor allem nach dem Schweregrad der Verletzung und dem Leidensdruck des Patienten. In den wenigsten Fällen ist eine akute operative Versorgung notwendig, sodass zunächst meist eine konservative Therapie (Medikamente, Physiotherapie/Krankengymnastik) eingeleitet werden kann. Bleiben die Beschwerden über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten bestehen oder kommt es zu einer Beschwerdezunahme, sollten chirurgische Optionen in Erwägung gezogen werden.
Konservative Therapie
Zur Schmerzreduktion und Entzündungshemmung können vorübergehend Schmerzmedikamente mit einer entzündungshemmenden Wirkung (Nichtsteroidale Antirheumatika wie zum Beispiel Naproxen Diclofenac oder Ibuprofen) eingesetzt werden. Diese wirken jedoch rein symptomatisch und beheben nicht die Ursache der Beschwerden. Von Injektionen mit Glucocorticoid(Cortison)-haltigen Präparaten in das Gelenk, sollte bei Bestehen einer Rotatorenmanschettenruptur abgesehen werden. Zwar kommt es hierdurch zu einer vorübergehenden Schmerzreduktion und Entzündungshemmung, jedoch zulasten der Sehnenqualität und reduzierten Chancen auf Einheilung im Falle einer späteren operativen Versorgung.
Wichtigstes Standbein der konservativen Therapie bei Verletzungen der Rotatorenmanschette ist die Physiotherapie. Durch Bewegungs-, Koordinations- und Kräftigungsübungen mit dem Ziel der Zentrierung des Oberarmkopfes in der Gelenkpfanne, kann es gelingen eine symptomatische Rotatorenmanschettenruptur auszugleichen und in eine asymptomatische Form zu überführen. Anfangs sollten diese Übungen unter Anleitung erfolgen, können im Verlauf aber auch gut in Eigenregie und zu Hause durchgeführt werden. Insbesondere bei intakter vorderer und hinterer Sehne oder bei einer isolierten Ruptur der Supraspinatussehne kann durch eine gezielte physiotherapeutische Behandlung eine Rotatorenmanschettenruptur ausgeglichen werden. Weitere Faktoren, die für eine konservative Therapie sprechen, sind zum Beispiel: geringer Leidensdruck (wenig Schmerzen, kaum Bewegungs- oder Kraftverlust), geringer Funktionsanspruch an die Schulter und schwere Begleiterkrankungen, die gegen eine Operation sprechen.
Operative Therapie
Hinsichtlich der operativen Therapie sind minimalinvasive Verfahren von konventionellen, offenen Techniken zu unterscheiden. Heutzutage können die allermeisten Patienten in der sogenannten Schlüssellochtechnik (Gelenkspiegelung, Arthroskopie) operiert werden. Mit Hilfe dieser minimalinvasiven Verfahren lassen sich Komplikationen der offenen Verfahren, wie zum Beispiel Infektionen, Wundheilungsstörungen, längere Rehabilitation oder ein schlechtes kosmetisches Resultat reduzieren.
Als Standardverfahren hat sich die arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschettenruptur durchgesetzt. Mithilfe von Fadenankern, die im Oberarmkopf eingebracht werden und deren Fäden durch die Sehne geschlungen werden, gelingt die Wiederbefestigung (Refixation) der Sehne am Knochen, wo sie im Verlauf wieder einheilen kann. Je nach Größe des Risses ist die Verwendung mehrerer Fadenanker notwendig um den Defekt vollständig zu verschließen.
Bei Teileinrissen kann unter Umständen ein sogenanntes Debridement ausreichend sein. Hierbei wird die Sehne geglättet, jedoch nicht rekonstruiert. Häufig wird dieses Verfahren auch kombiniert eingesetzt. Es wird also zum Beispiel die partiell lädierte Sehne debridiert und die komplett gerissene Sehne refixiert.
Bei ausgedehnten Rupturen und/oder weit zurückgezogenen Sehnenenden kann es vorkommen, dass eine konventionelle Rekonstruktion der Rotatorenmanschette nicht mehr möglich ist. In diesen Fällen bestehen weitere Optionen wie zum Beispiel die Teilrekonstruktion der Rotatorenmanschette oder invasivere Eingriffe wie der Muskeltransfer, bei dem ein anderer intakter Muskel von seinem Ansatz abgelöst und im Bereich der gerissenen Rotatorenmanschette wieder am Knochen fixiert wird. Diese Operation ist jedoch nur sehr selten nötig.
Auch neuere Verfahren, wie die Wiederherstellung der oberen Gelenkkapsel mit synthetischen, tierischen oder humanen (Spender-)Materialen sind möglich, jedoch noch Gegenstand der aktuellen Forschung.
Kommt es bei einer ausgedehnten Rotatorenmanschettenruptur zu einer Defektarthropathie, so ist bei entsprechendem Leidensdruck in der Regel eine prothetische Versorgung (Gelenkersatz) angebracht.
Nachsorge
Um eine Einheilung der Sehne(n) zu gewährleisten, wird die Schulter nach der Operation für vier bis sechs Wochen in einer sogenannten Orthese (Schlinge) ruhiggestellt. In dieser Zeit erfolgt ausschließlich eine passive Mobilisation (Bewegung der Schulter von außen) durch die Physiotherapie. Im Anschluss daran wird mit zunehmender aktiver Mobilisation (eigenständige Bewegung der Schulter) begonnen und die Muskulatur gekräftigt. Eine Belastung der Schulter ist für 10 bis 12 Wochen zu vermeiden. Eine Rückkehr zum Sport kann in Absprache mit dem Operateur nach etwa drei Monaten erfolgen.