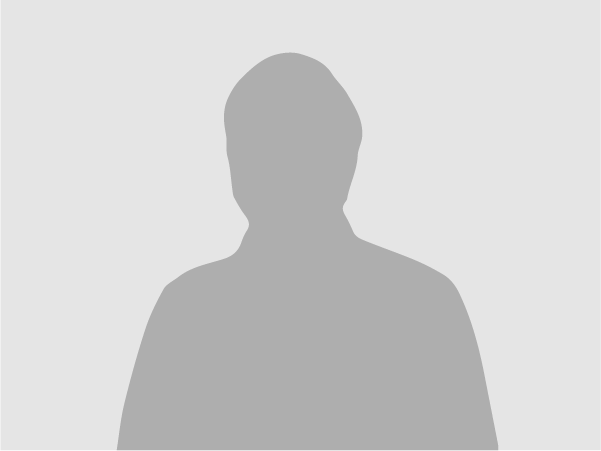Piriformis-Syndrom
Das Piriformis-Syndrom ist eine muskuläre Fehlspannung eines Gesäßmuskels (Musculus piriformis), welches zu lokalen Muskelschmerzen führen kann, aber auch die in direkter Nachbarschaft verlaufenden Nerven komprimieren, das heißt drücken oder quetschen kann, wie zum Beispiel den Ischiasnerv. Dies kann zu ausstrahlenden Schmerzen in den Versorgungsgebieten dieser Nerven führen (Gesäß und Bein).

Häufigkeit
Genaue Angaben zur Häufigkeit des Piriformis-Syndroms existieren nicht, auch unter den Fachleuten herrscht keine übereinstimmende Meinung hinsichtlich der Häufigkeit und Seltenheit der Erkrankung. Vielen Menschen dürfte allerdings zumindest ein Teil des Piriformis-Syndroms bekannt vorkommen, wenn man die Ursachen und Risikofaktoren samt der Symptome und des Verlaufs berücksichtigt (siehe unten).
Ursachen und Risikofaktoren
Zu den möglichen Ursachen des Piriformis-Syndroms zählen eine Überlastung des Muskels durch direkte Verletzungen (zum Beispiel Sturz oder Schlag auf das Gesäß, Ausrutschen mit Zerrung) oder chronisch durch Fehlhaltungen (zum Beispiel längeres Sitzen in schlechter Position, häufiger und längerer „Portemonnaiedruck“ mit verminderter Durchblutung des Muskels, Ausgleich/Kompensation anderer Muskelschwächen oder Becken- bzw. Wirbelsäulenblockierungen, welche zu einem „Teufelskreis“ führen).
Symptome und Verlauf
Da der Musculus piriformis fünf verschiedene Nerven komprimieren kann, können viele verschiedene Schmerzsymptome auftreten und zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall „vortäuschen“ bzw. ähnliche Symptome hervorrufen. Ist der Ischiasnerv (Nervus ischiadicus) betroffen, zeigen sich häufig ausstrahlende Beschwerden bis in den Fuß mit eventuellen Muskelschwächen, welche meistens unter Belastung des betroffenen Beines auftreten. Bei Druck auf den oberen und unteren Gesäßnerv (Nervus gluteus superior und Nervus gluteus inferior) kann es zu leichten Muskelschwächen im Bereich des Beckens und der Hüften kommen mit beispielsweise Schwierigkeiten beim Aufstehen von einem Stuhl oder den ersten Schritten nach längerem Sitzen, eventuell auch einem leichten Watschelgang (auch bezeichnet als Trendelnburg-Zeichen, Duchenne-Zeichen). Bei Irritation des Schamnervs (Nervus pudendus) und des hinteren Hautnervs des Oberschenkels (Nervus cutaneus femoris posterior) kommt es zu Missempfindungen im Unterleib-/Genitalbereich. Die Dauer der Beschwerden ist abhängig von der „Verhärtung“/Fehlspannung des Musculus piriformis. Dies kann sich spontan lösen oder aber über andere Mechanismen/Therapien gelockert bzw. normalisiert werden (siehe Therapie).
Diagnostik
Die Diagnose „Piriformis-Syndrom“ wird durch die körperliche Untersuchung und ein Abtasten des Patienten durch den Arzt (klinisch manuelle Untersuchung) unter Zuhilfenahme der Patientenbefragung (Anamnese) gestellt. Weitere diagnostische Untersuchungen, zum Beispiel bildgebende Verfahren wie CT/MRT oder neurologische Messungen der Nervenleitgeschwindigkeit (ENG – Elektroneurographie) und Muskelaktivität (EMG – Elektromyographie) dienen unter Umständen zum Ausschluss anderer Erkrankungen bei nicht eindeutigem klinisch manuellem Untersuchungsbefund und ausbleibender Besserung unter den eingeleiteten Therapiemaßnahmen.
Therapie
Das Piriformis-Syndrom wird überwiegend manualtherapeutisch, das heißt mit einer speziellen Krankengymnastik, behandelt. Je nach Ursache wird direkt lokal intramuskulär (im Piriformismuskel liegend) mit manuellen Techniken (zum Beispiel Strain-Counterstrain oder Fascial Flush) oder extramuskulär (außerhalb des Piriformismuskels liegend) an den jeweilig gestörten Körperregionen (zum Beispiel Becken/Kreuzdarmbeingelenk/Wirbelgelenke) behandelt. Zusätzlich ist meistens ein individuelles Trainings-und Selbstbehandlungsprogramm mit Dehn- und Kräftigungsüben äußerst hilfreich. Eventuell verursachende Faktoren wie zum Beispiel eine schlechte Sitzposition, längeres Autofahren oder die Aufbewahrung des Portemonnaies in der hinteren Hosentasche sollten zudem vermieden bzw. unterlassen werden. Bei ausbleibender Besserung wird eventuell die Diagnostik erweitert (siehe oben), darüber hinaus kann zusätzlich unter anderem die Akupunktur (Dry-Needling), Stoßwellentherapie oder Neuraltherapie von Triggerpunkten eingesetzt werden. Schmerzmedikamente können in der akuten Phase kurzfristig eine Linderung bringen und eingesetzt werden, sind jedoch dauerhaft nicht beschwerdelindernd.
Literatur und weiterführende Links
Bischoff, H.-P. / Heisel, J. / Locher, H.-A.: Praxis der konservativen Orthopädie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2007.
Mumenthaler, M. / u.a.: Läsionen peripherer Nerven und radikulärer Syndrome. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2007.
Gautschi, R.: Manuelle Triggerpunkt-Therapie; Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2016.
Garten, H.: Applied Kinesiology Funktionelle Myodiagnostik; Osteopathie und Chirotherapie. München: Urban & Fischer,2016.
Matzen, P. / u.a.: Neuroorthopädie. Berlin: Walter de Gruyter, 2017.
Schünke, M. / u.a.: Prometheus LernAtlas der Anatomie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2014.