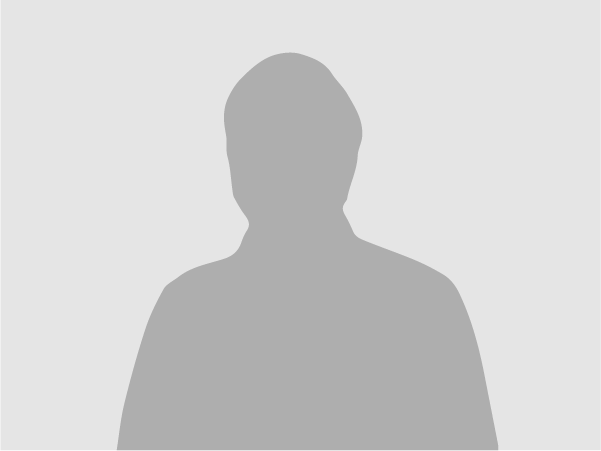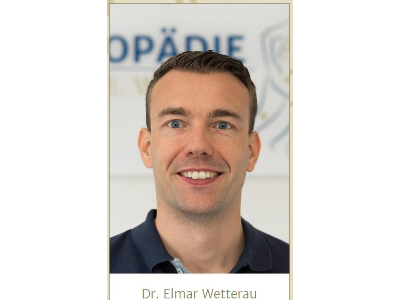Chondrokalzinose
Die Chondrokalzinose bezeichnet eine krankhafte Mineralisation des Gelenkknorpels oder anderer knorpelartiger Strukturen wie zum Beispiel Menisken. Am häufigsten handelt es sich dabei um Calciumphosphat-Ablagerungen. Viele Gelenke bereiten trotz erkennbarer Mineralisation keine Beschwerden.

Kommt es zum Ausbruch der Kristalle aus dem Knorpel, können mitunter heftige Gelenkschmerzen auftreten (Pseudogicht). Da das Auftreten einer Chondrokalzinose sehr häufig im Rahmen einer Arthrose zu beobachten ist, besteht insgesamt ein sehr variables Beschwerdebild.
Auftreten und Häufigkeit
Die genaue Krankheitshäufigkeit von Mineralisationen des Gelenkknorpels ist nicht bekannt. Allerdings deuten neuere Studien auf ein sehr viel häufigeres Auftreten als bisher angenommen hin. Es besteht dabei eine enge Verbindung zwischen dem Auftreten von Mineralisationen und degenerativen Gelenkerkrankungen. Betroffen sind vor allem die großen Gelenke, am häufigsten das Kniegelenk, gefolgt vom Schulter-, Sprung-, und Ellenbogengelenk.
Ursachen
Die Ursachen der Mineralisation der Gelenkknorpel sind nicht vollständig verstanden. Minerale bilden sich unter anderem durch die Kristallisation von Lösungen. Typischerweise unterscheidet man hierbei vier Klassen von Kristallen, die mit krankhaften Ablagerungen einhergehen können. Hierzu gehören Calciumpyrophosphatdihydrat (CPPD), basische Calciumphosphate (BCP), Harnsäurekristalle und Calciumoxalatkristalle. Da nicht alle dieser Mineralverbindungen im Röntgenbild nachweisbar sind, werden vor allem die CPPD-Ablagerungen als Chondrokalzinose bezeichnet. Neuere Studien zeigen jedoch, dass vor allem BCP-Ablagerungen sehr viel häufiger innerhalb des Gelenkes nachgewiesen werden können, als bisher angenommen. Bei Patienten mit fortgeschrittener Arthrose ist dies sogar in 100 Prozent der Fälle zu beobachten. Daher wird den BCP-Kristallen eine wichtige Bedeutung im Krankheitsprozess der Arthrose zugeschrieben.
Grundlegend für CPPD-Ablagerungen ist eine Stoffwechselstörung, die eine Erhöhung der Konzentration von extrazellulären (außerhalb der Zelle gelegenen) Pyrophosphaten bewirkt. Daneben gehen eine Reihe von metabolischen und endokrinologischen Erkrankungen mit einer vermehrten CPPD-Ablagerung einher. Zu diesen Erkrankungen gehören unter anderem Hyperparathyreodismus, Morbus Wilson, Hämochromatose und Hypophosphatasie.
Symptome und Verlauf
Viele Gelenke, in denen Mineralablagerungen im Knorpel nachgewiesen werden, verursachen keine Beschwerden. Kommt es jedoch zum Ausbruch von Kristallen aus der Knorpelmatrix, können akute, teils heftige Gelenkschmerzen auftreten. Daher wird die Erkrankung auch als Pseudogicht bezeichnet. In der Regel treten diese anfallsartigen Schmerzen in einem Gelenk auf, an erster Stelle im Kniegelenk, gefolgt vom Schulter-, Sprung-, und Ellenbogengelenk. Zusätzlich zu den anfallsartigen Schmerzen kann eine Gelenkschwellung mit Ergussbildung und Überwärmung auftreten. Die chronische Ablagerung von Calciumphosphaten ist in ihren Symptomen nicht von der Arthrose zu unterscheiden. Hierbei bestehen vor allem Anlauf- und Belastungsschmerzen mit Bewegungseinschränkungen der Gelenke.
Diagnose
Im Röntgenbild sind die Mineralisationen als typische Verschattungen im Gelenkspalt zu erkennen. Im Kniegelenk können sie je nach Lokalisation Ausdruck eines mineralisierten Gelenkknorpels oder eines mineralisierten Meniskus sein. Erkennbar sind die Mineralisationen jedoch nur, wenn sie in ausreichender Menge vorhanden sind und der Gelenkspalt noch weitgehend erhalten ist. Ein direkter Nachweis von CPPD-Kristallen kann durch eine Punktion des Gelenks mit Entnahme von Gelenkflüssigkeit erfolgen. Hierbei zeigen sich lichtmikroskopisch typische stäbchenförmige Kristalle, welche anhand der Form gut von Harnsäurekristallen, wie sie bei der Gicht auftreten, unterschieden werden können.

Therapie
Eine spezifische Therapie existiert nicht. Bei einen durch Calciumphosphat-Ablagerungen verursachten akuten Schmerzanfall können entzündungshemmende und schmerzreduzierende Medikamente, wie zum Beispiel Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), für einige Tage eingenommen werden. Zudem wirkt eine lokale Kälteanwendung schmerzreduzierend. In der Regel tritt eine spontane Besserung der Beschwerden bereits nach wenigen Tagen auf. Im fortgeschrittenen Stadium von krankhaften Mineralisierungen können auch entzündungshemmende Kortisoninjektionen in das Gelenk erfolgen. Die Therapieansätze ähneln denen der Arthrose. Ist es durch die Mineralisation zu einem fortgeschrittenen Gelenkverschleiß gekommen, kann eine endoprothetische Versorgung des Gelenkes die Beschwerden deutlich verbessern.
Nachsorge
Ein spezielles Nachsorgeprogramm für Patienten mit krankhaften Mineralisationen besteht nicht. Prinzipiell gelten die gleichen Therapiekonzepte wie für Patienten mit einem degenerativen Gelenkverschleiß.
Literatur und weiterführende Links
Rüther, Wolfgang / Lohmann, Christoph: Orthopädie und Unfallchirurgie. Elsevier, 2014.
Rehart, S. / Sell, S. (Hrsg.): Expertise: Orthopädische Rheumatologie. Thieme, 2015.