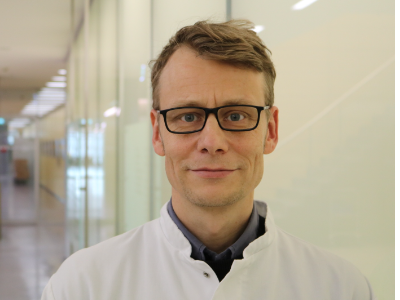Spondylodese
Unter einer Spondylodese (umgangssprachlich häufig „Versteifung“ genannt) versteht man das knöcherne Zusammenwachsen mehrerer Wirbel, heutzutage in der Regel durchgeführt als sogenannte Instrumentationsspondylodese unter Verwendung von Wirbelsäulenimplantaten, bei verschiedenen Erkrankungen der Wirbelsäule, die von einer solchen Stabilisierung profitieren.

Einsatzgebiete
- Verschleißbedingte (degenerative) Erkrankungen der Wirbelsäule (degenerative Instabilitäten, Osteochondrosen, Segmentdegeneration)
- Korrektur von Wirbelsäulendeformitäten (Skoliose, Kyphose, Gleitwirbel)
- Stabilisierung von Wirbelsäulentumoren
- Stabilisierung von Wirbelsäuleninfektionen (Spondylodiszitis)
- Stabilisierung von Wirbelfrakturen bzw. -verletzungen
Wirkprinzip
Der Begriff Spondylodese bedeutet, dass im Rahmen einer Operation mehrere Schritte durchgeführt werden, um nach einigen Monaten aus zwei oder mehreren Wirbeln einen soliden Knochenblock zu schaffen. Dabei wird sowohl der operative Schritt zur Herstellung des später entstehenden Knochenblockes als auch das spätere Ergebnis des Knochenblockes selbst als Spondylodese bezeichnet.
Bei den verschiedenen Erkrankungen ist eine Stabilisierung eines Wirbelsäulenabschnittes heutzutage mittels moderner Implantate sehr gut möglich. Damit die Implantate, die in der Regel dauerhaft im Körper belassen werden können, langfristig mechanisch entlastet werden und es nicht zu einem Implantatversagen kommt, ist es wichtig, den mit Implantaten versorgten Bereich der Wirbelsäule so zu bearbeiten, dass im Laufe der Monate ein Knochenblock, entsteht. Dieser ist dann stabil in seiner Form und die Implantate werden entlastet.
Degenerative Erkrankungen
Der Verschleiß einzelner Wirbelsäulensegmente im Rahmen degenerativer Erkrankungen führt in der Regel zu Schmerzen, die vor allem bei Bewegung des Segmentes verstärkt auftreten. Das „Stilllegen“ eines Segmentes mittels einer Spondylodese soll den Anteil des Schmerzes ausschalten, der durch die Bewegungen entsteht. Im natürlichen Verlauf kann es bei einem schwergradig degenerierten Segment, auch unabhängig von einem operativen Eingriff, schließlich zu einer Verknöcherung kommen, welche allerdings bis zur ihrer vollständigen Knochenblockbildung Jahrzehnte benötigt. Durch eine Operation wird dieser natürliche Verlauf abgekürzt.
Korrektur von Deformitäten
Bei der Korrektur von Deformitäten werden die deformierten Wirbelsäulen-Bereiche im Rahmen der Spondylodese mit Implantaten besetzt. Es wird eine Formkorrektur der Deformität durchgeführt, die durch das Einbringen von Stäben aufrechterhalten wird. Langfristig fusionieren die mit Implantaten versehenen Wirbelkörper, das heißt sie wachsen zu einem Knochenblock im Sinne einer Spondylodese zusammen. Die Korrektur muss dann nicht mehr primär über die Implantate gehalten werden, da der Knochenblock selbst stabil in seiner Form ist und die Implantate somit mechanisch entlastet werden.
Tumoren und Infektionen
Bei Tumoren der Wirbelsäule führt das Einbringen der Implantate zu einer primären Stabilität, die ein mechanisches Versagen der Wirbelsäule verhindern. Die Durchführung einer Spondylodese führt auch hier zu einer langfristigen knöchernen Stabilität mit Entlastung der Implantate. Gleiches gilt für Infektionen der Wirbelsäule, wobei bei letzteren das Ruhigstellen des betroffenen Wirbelsäulenbereiches an sich therapeutisch bereits förderlich für das Ausheilen der Infektion ist.
Wirbelsäulenverletzungen
Bei Wirbelsäulenverletzungen und -frakturen dient das Einbringen der Implantate der sofortigen Stabilisierung der Wirbelsäule. Für den Fall, dass die Beweglichkeit eines Wirbelsäulensegmentes nach Abheilen eines Wirbelbruches wieder freigegeben werden soll (durch die Entfernung der Implantate), wird keine Spondylodese hervorgerufen. Soll das Wirbelsäulensegment nicht wieder freigegeben werden, wird in der Regel eine Spondylodese hervorgerufen, um wie bei den oben genannten Erkrankungen die Implantate langfristig zu entlasten.
Wenn eine Spondylodese beabsichtigt war, der Körper des Patienten allerdings nicht erfolgreich einen Knochenblock bildet, spricht man von einer sogenannten Pseudarthrose, das heißt ein Bereich der Wirbelsäule, der eigentlich knöchern stabil sein sollte, ist dies nicht, sondern wird lediglich über die Implantate gehalten, die dann aber im Verlauf häufig aufgrund mechanischer Überlastung versagen, indem sie zum Beispiel brechen.
Durchführung
In den Anfängen der Wirbelsäulenchirurgie, als die Implantatentwicklung noch in den Kinderschuhen steckte, beinhaltete die Spondylodese nicht zwingend das Einbringen von Fremdmaterialien oder Implantaten. Häufig wurde lediglich das Anfrischen des Knochens (das heißt die Knochenrinde (Kortikalis) wird eröffnet, sodass für die Knochenblockbildung wertvolle Substanzen aus dem Knochenmark freigesetzt werden) und das Anbringen von Eigen- oder Fremdknochen durchgeführt. Ohne das Einbringen von stabilisierenden Implantaten war der jeweilige Wirbelsäulen-Abschnitt nicht sofort stabil. Die Patienten mussten deshalb häufig lange Zeit in einem Korsett oder sogar im Bett, teils in einem Gipsbett, verbringen, bis die Knochenblockbildung vom Körper stabil abgeschlossen war.
Heutzutage wird eine Spondylodese in der Regel unter Zuhilfenahme von Implantaten (Schrauben, Haken, Cages, Bänder, Cerclagen, etc.) durchgeführt, man spricht dann von einer sogenannten instrumentierten Spondylodese oder Instrumentationsspondylodese. Die Implantate stabilisieren den betroffenen Wirbelsäulenabschnitt sofort, das heißt es ist eine sogenannte Primärstabilität gegeben. Die Patienten dürfen sich meistens sofort wieder bewegen. Die Implantate sichern die Stabilität so lange, bis die Knochenblockbildung abgeschlossen ist und somit der Knochenblock selbst in sich stabil ist. Zusätzlich zum Einbringen der Implantate erfolgt das Anfrischen des Knochens und das Anlagern von eigenem Knochen oder Spenderknochen oder alternativ von Knochenersatzmaterialien, um die Knochenblockbildung zu fördern bzw. hervorzurufen.
Erfolgsaussichten
Bei einer operativen instrumentierten Spondylodese handelt es sich heutzutage um einen Routine-Eingriff mit sehr guten Erfolgsaussichten. Zahlreiche Faktoren beeinflussen den Erfolg der Knochenblockbildung, zum Beispiel die Grunderkrankung, bestehende Nebenerkrankungen, die Knochenqualität, Lebensstilfaktoren wie Rauchen, das Körpergewicht oder mechanische Faktoren.