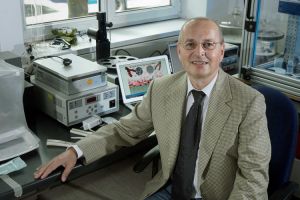Knieprothesenwechsel
Jede Endoprothese hat eine begrenzte Haltbarkeit und das ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sie implantiert wurde. Denn sowohl der Knochen um die Gelenke herum unterliegt mit der Zeit gewissen Veränderungen, als auch die verschiedenen Teile der Prothese, die von Abrieb und Verschleiß betroffen sind. Aus diesem Grunde wird bei zunehmender Zahl an Erstimplantationen von Knieprothesen auch die Zahl der Wechseloperationen (Revisionen) in Zukunft steigen.

Einsatzgebiete
Die Wechselendoprothetik ist die logische Konsequenz der Primärendoprothetik im Bereich des Kniegelenkes. Ein künstlicher Gelenkersatz ist in seiner Haltbarkeit begrenzt, was, wie bereits oben ausgeführt, zum einen der Veränderung des Körpers und des Knochens um die Prothese herum geschuldet ist, zum anderen aber auch der Tatsache, dass die täglich aufeinander reibenden Gleitpartner der Prothese, hier Metall auf Kunststoff, einem Abrieb unterliegen, der langfristig zu entzündlichen Veränderungen und Lockerungen führt.
Die weiteren Ursachen für Beschwerden nach dem Einsatz eines künstlichen Kniegelenkes sind aufgrund der Komplexität des Gelenkes zahlreich. Unterschieden werden müssen neben der Lockerung der Prothese auch andere Ursachen. Es gibt bei zahlreichen Patienten operationsbedingte Faktoren, die zu Restbeschwerden und damit in bestimmten Fällen zu einer erneuten Operation führen können. Dazu zählt zum Beispiel eine überschießende Vernarbung des Weichteilgewebes um das Kniegelenk, die zu einer deutlichen Bewegungseinschränkung führt, aber auch das Versagen oder Nachlockern von Bändern und eine überschießende Produktion von Gelenkschleimhaut. Ebenso kann der nicht optimale Einbau der Knieprothese zu Restbeschwerden führen.
In diesen Fällen ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob konservative Maßnahmen ausreichen oder ob eine erneute Operation notwendig ist. Der Hauptgrund, der zu einer Re-Operation führt, ist jedoch die Lockerung des künstlichen Gelenkes (siehe Abb. 1).

Durchführung
Das Ausmaß der Wechseloperation hängt eindeutig von den wechselauslösenden Ursachen ab. Sind Komponenten gelockert, so müssen diese gewechselt werden. Häufig finden sich Lockerungen nur am Ober- oder nur am Unterschenkel, teilweise ist auch nur die Kunststoffauflage am Unterschenkel verschlissen und muss ausgewechselt werden. Meist bedarf es beim Wechsel des künstlichen Kniegelenkes eines höheren Kopplungsgrades, das heißt häufig muss nach einem normalen Oberflächenersatz ohne zusätzliche Kopplung der Prothesenteile dann eine teilgekoppelte Prothese gewählt werden. In vielen Fällen ist bei der Revision auch eine andere Verankerung im Knochen über Stiele notwendig (siehe Abb. 2) um langfristig eine gute Haltbarkeit zu gewährleisten.
Das Ziel des Wechsels ist wie bei der Erstversorgung ein stabiles, gut bandgeführtes oder eben prothesengeführtes Knie mit adäquater Ausrichtung der Beinachse, um langfristig wenig Abrieb und keine Lockerung zu provozieren bei hoher Zufriedenheit des Patienten. Aus diesem Grunde sollte man gerade bei jüngeren Patienten bereits beim ersten Kunstgelenk an den späteren Wechsel denken. Die steigende Lebenserwartung macht eine Revision des Kunstgelenkes wahrscheinlicher. Deswegen sollte so knochenschonend wie möglich operiert werden.

Für den komplexen Revisionsfall gibt es spezielle Endoprothesen. Sie müssen häufig länger und voluminöser sein, um die Verankerung im Knochen zu sichern. Es gibt sie meist in Form von modularen Baukastensystemen, die speziell für den Wechsel entwickelt wurden. Oft erkennt der Operateur erst während des Eingriffes, welche Dimension an Defekten die gelockerte Endoprothese verursacht hat. Mit Hilfe von verschiedenen Schaftvarianten und Knochenersatzmaterialien können diese Schäden überbrückt und wieder versorgt werden. Es ist somit unverzichtbar, dass die operierende Klinik eine große Auswahl an Wechselendoprothesen bereithält.
Erfolgsaussichten
Die Erfolgsaussichten sind bei korrekter Indikation, ausreichender Erfahrung des Operateurs und adäquater Prothesenwahl groß. Auch wenn ein Wechsel tendenziell nicht so lange hält wie eine Erstimplantation, so kann man auch nach einem Wechsel von einer langen Standzeit und hohen Zufriedenheit ausgehen. Der Träger kann die Haltbarkeit seines Implantates selber positiv beeinflussen, indem er sich an die Vorgaben seines Arztes hält, für ein moderates Körpergewicht sorgt und gelenkschonende Aktivitäten pflegt. Das Ziel ist die sportliche Aktivität mit prothesengeeigneten Sportarten wiederzuerlangen. Auch nicht beeinflussbare Faktoren wie die Knochenqualität und weitere Begleiterkrankungen wirken sich auf die Haltbarkeit aus. Fakt ist, dass bei plötzlich auftretenden Beschwerden nach langer Zufriedenheit dringend ärztlicher Rat in Anspruch genommen werden sollte.