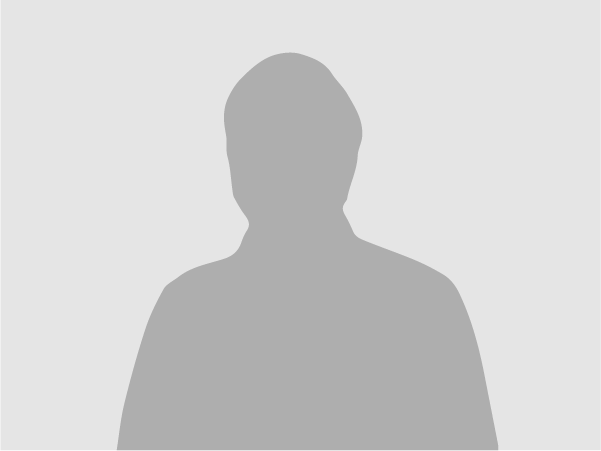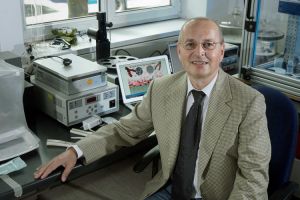Hüftprothesenwechsel
Bei einer zunehmenden Zahl von Erstimplantationen künstlicher Hüftgelenke wird es zwangsläufig auch zu einer Zunahme der Wechseloperationen (Revisionen) kommen. Es ist prinzipiell davon auszugehen, dass nach einem gewissen Zeitraum jegliche Endoprothese des Hüftgelenkes eines Wechsels bedarf. Es kommt einerseits zu einer Veränderung des Knochens um die Prothese herum, was zur Lockerung führen kann, zum anderen wird zwischen den Gleitpartnern, sprich zwischen Kugel und Pfanne Abrieb produziert. Dieser Abrieb führt zwangsläufig irgendwann zur Lockerung der Hüftprothese.

Einsatzgebiete
Der Wechsel eines künstlichen Hüftgelenkes ist immer dann erforderlich, wenn die Prothese gelockert ist, oder im Röntgenbild klare Verschleißveränderungen, sprich eine Dezentrierung des Hüftkopfes oder ähnliches, zu sehen sind. Üblicherweise bemerkt der Patient dies in Form von Schmerzen nach langjähriger Beschwerdefreiheit.
Wirkprinzip
Das Wirkprinzip des Hüftprothesenwechsels entspricht letztendlich dem Wirkprinzip des primären Hüfteinbaus. Kopf und Pfanne müssen ersetzt werden. In diesem Fall sind es aber nicht der originäre Kopf und die originäre Pfanne, sondern die bereits eingebaute Hüfttotalendoprothese, die gelockert ist. In vielen Fällen ist nur entweder die Pfanne oder nur der Schaft, auf dem der Prothesenkopf steckt, gelockert. Es kann aber auch sein, dass beide Gleitpartner gelockert sind und eines Wechsels bedürfen. Nicht in jedem Fall muss bei nachgewiesener gelockerter Pfanne oder gelockertem Schaft ein Wechsel durchgeführt werden. Dies muss im Einzelfall entschieden werden. Liegt der Grund für die Beschwerdeproblematik in einem Verschleiß, so kann, wie gesagt, auch ein isolierter Komponentenwechsel sinnvoll sein.
Durchführung
Bei nachgewiesener Lockerung (siehe Abb. 1) ist in der Vielzahl der Fälle eine zeitnahe Wechseloperation ratsam, da die gelockerte Prothese den Knochen weiter schädigen kann. Es bewegt sich hier ein Metallteil in körpereigenem Knochen. Moderne Prothesen haben aufsteckbare Kugelköpfe. Die Köpfe bestehen zumeist aus Keramik oder Metall, die Inlays aus Kunststoff oder Keramik.

Das Ausmaß der Wechseloperation ist von verschiedenen Faktoren abhängig, so zum Beispiel vom Alter des Patienten, der Größe des lockerungsbedingten Knochendefektes oder der Art der Verankerung. In besonderen Fällen kommen sogenannte modulare Wechsel- oder Revisionsprothesen zum Einsatz (Abb. 2). Der Vorteil besteht darin, dass diese aus verschiedenen frei kombinierbaren Einzelkomponenten bestehen. Damit kann jeder Knochendefekt bzw. jede Instabilität individuell therapiert werden. Insbesondere die Beinlänge und die Stabilität des Hüftgelenkes können somit optimal beeinflusst werden.

Um der jeweiligen Defektsituation des Knochens und den gelockerten einliegenden Prothesen während der Operation gerecht zu werden, ist zum einen die Erfahrung des Operateurs von großer Bedeutung, zum anderen aber auch die Ausstattung der Klinik. Eine Klinik, die Wechselendoprothetik betreibt, sollte daher eine Vielzahl an Implantaten im Hause haben, um jeder Situation gerecht zu werden. Für die Auffüllung von Knochendefekten ist außerdem zum Beispiel eine Knochenbank oder die Verfügbarkeit von Spenderknochen von wesentlicher Bedeutung. Die Rehabilitation beginnt am ersten Tag nach der Operation mit Bewegungsübungen, ab dem zweiten Tag wird das Laufen mit Gehhilfen geübt. Im Anschluss an den kurzen stationären Krankenhausaufenthalt wird die Behandlung in einer Rehabilitationsklinik oder ambulant fortgesetzt.
Erfolgsaussichten
Die Erfolgsaussichten einer Revisionsoperation sind hoch. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass sich der Patient, wenn er viele Jahre beschwerdefrei war, bei ersten Beschwerdeanzeichen frühzeitig meldet, damit die Wechselsituation frühzeitig erfasst und behandelt werden kann. Erfolgt dies nicht, so resultieren häufig extrem große Knochendefekte, deren Wiederherstellung sehr viel aufwändiger ist, als die kleinerer Knochendefekte. Somit ist die diesbezügliche Sensibilität des Patienten von großer Bedeutung. Das Ausmaß des Defektes und damit das Ausmaß der Operation beeinflussen natürlich automatisch auch die Erfolgsaussichten. Je größer der Knochendefekt, insbesondere im Bereich des Prothesenschafts, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Muskelansätze in Mitleidenschaft gezogen wurden. Damit sind die Erfolgsaussichten nicht mehr so gut wie bei der Primärendoprothetik.
FAQ - Häufig gestellte Fragen: Hüftprothesenwechsel
Was ist ein Hüftprothesenwechsel?
Ein Hüftprothesenwechsel ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem eine bereits implantierte Hüftprothese entfernt und durch eine neue Prothese ersetzt wird. Dies wird in der Regel durchgeführt, wenn die ursprüngliche Prothese abgenutzt, locker geworden oder anderweitig beschädigt ist.
Warum ist ein Hüftprothesenwechsel erforderlich?
Ein Hüftprothesenwechsel kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, einschließlich einer Lockerung der Prothese, Infektion, Materialverschleiß, Bruch der Prothesenkomponenten oder einer Verschlechterung des Knochengewebes um die Prothese herum.
Wie lange hält eine Hüftprothese normalerweise?
Die Lebensdauer einer Hüftprothese kann je nach individuellen Faktoren wie Alter, Aktivitätsniveau und Knochenqualität variieren. In der Regel werden Hüftprothesen jedoch so konzipiert, dass sie etwa 15 bis 20 Jahre halten.
Wie verläuft der Hüftprothesenwechsel?
Beim Hüftprothesenwechsel wird der ursprüngliche Prothesenschaft und die Prothesenkugel entfernt. Anschließend wird der Knochen gereinigt und vorbereitet, um die neue Prothese sicher zu implantieren. Die neue Prothese wird dann in den Knochen eingesetzt und der Weichteilbereich um die Hüfte wieder verschlossen.
Wie lange dauert die Genesung nach einem Hüftprothesenwechsel?
Die Genesung nach einem Hüftprothesenwechsel kann individuell variieren, aber in der Regel dauert es einige Wochen bis Monate, bis der Patient seine normale Aktivität wieder aufnehmen kann. Eine Physiotherapie wird in der Regel empfohlen, um den Heilungsprozess zu unterstützen und die Beweglichkeit und Stärke der Hüfte wiederherzustellen.
Gibt es Risiken oder Komplikationen bei einem Hüftprothesenwechsel?
Wie bei jedem chirurgischen Eingriff gibt es auch beim Hüftprothesenwechsel Risiken und Komplikationen. Dazu können Infektionen, Blutungen, Thrombosen, Verletzungen von Blutgefäßen oder Nerven, Lockerung der neuen Prothese oder Probleme mit der Wundheilung gehören. Ihr Arzt wird Sie über die möglichen Risiken aufklären.